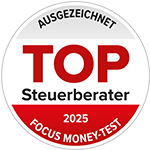Das Bundesfinanzministerium hat einen Referentenentwurf mit diesem Titel veröffentlicht: „Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen“. Aus dem 50 Seiten umfassenden Entwurf werden drei Aspekte für Grundstücke vorgestellt. Es handelt sich um eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert, die Kaufpreisaufteilung und den Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer.
Eigenbetrieblich genutzte Grundstücke von untergeordnetem Wert
Derzeitige Regelung
Nach § 8 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) brauchen eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile nicht als Betriebsvermögen behandelt zu werden, wenn
- ihr Wert nicht mehr als ein Fünftel des gemeinen Werts des gesamten Grundstücks (relative Grenze) und
- nicht mehr als 20.500 EUR (absolute Grenze) beträgt.
Werden die Grenzen nicht überschritten, hat der Steuerpflichtige also ein Wahlrecht: Er kann den Raum als Privat- oder als Betriebsvermögen behandeln. Entscheidet er sich für Privatvermögen, ist Folgendes zu bedenken:
- Die auf diesen Raum entfallenden Aufwendungen können grundsätzlich als Betriebsausgaben abgezogen werden. Der Abschreibungsbetrag richtet sich jedoch nach den Abschreibungsmethoden für Privatgebäude, da kein Betriebsvermögen vorliegt.
- Wird der betrieblich genutzte Grundstücksteil als Privatvermögen behandelt, ist in jedem Folgejahr zu prüfen, ob die Voraussetzungen (Grenzen des § 8 EStDV) noch erfüllt werden.
Beachten Sie | Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch etwaige stille Reserven. Bei einer Behandlung als Betriebsvermögen unterliegen Wertzuwächse bei einer Entnahme oder Veräußerung des Grundstücksteils der Besteuerung. Handelt es sich demgegenüber um Privatvermögen, ist ein Veräußerungsgewinn nur unter den Voraussetzungen des
§ 23 Einkommensteuergesetz (EStG) zu versteuern. Vereinfacht ausgedrückt: Nach Ablauf der Zehnjahresfrist erfolgt keine Besteuerung.
Geplante Änderungen
- 8 EStDV soll nun geändert werden – und zwar wie folgt: Eigenbetrieblich genutzte Grundstücksteile brauchen nicht als Betriebsvermögen behandelt zu werden, wenn ihre Größe nicht mehr als 30 Quadratmeter oder ihr Wert nicht mehr als 40.000 EUR beträgt (Satz 1). In diesem Fall dürfen Aufwendungen, die mit dem Grundstücksteil im Zusammenhang stehen, nicht abgezogen werden (Satz 2).
| Merke | Durch den neuen Satz 1, der in allen noch offenen Fällen anwendbar sein soll, würde sich die jährliche Überprüfung, ob die Voraussetzungen noch vorliegen, oft erübrigen, da sich die Quadratmeter regelmäßig nicht ändern. Ist der Grundstücksteil nicht größer als 30 Quadratmeter, sind keine weiteren Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Wahlrechts notwendig. Nur in den Fällen, in denen die maximale Quadratmeterzahl überschritten wird, erfolgt in einem zweiten Schritt die Prüfung anhand der absoluten Wertgrenze. |
So viel zu den guten Nachrichten. Denn für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2025 beginnen, soll Satz 2 anwendbar sein. Dadurch wäre ein Abzug von Aufwendungen, die mit dem Grundstücksteil im Zusammenhang stehen, in den Fällen, in denen das Wahlrecht ausgeübt wird (also Privatvermögen vorliegt), nicht mehr möglich. Folglich würde die Wertermittlung für die Berechnung der Abschreibung entfallen.
Beachten Sie | Die betriebsbezogenen Aufwendungen wie z. B. Strom und Heizkosten sollen aber weiterhin abzugsfähig sein.
Kaufpreisaufteilung
Wurde für ein bebautes Grundstück ein Gesamtkaufpreis gezahlt, ist der Kaufpreis zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abschreibung des Gebäudes aufzuteilen. Denn nur die Anschaffungskosten für das Gebäude unterliegen einem Wertverzehr und mindern über die Abschreibung den steuerlichen Gewinn. Der Grund und Boden hingegen unterliegt keinem Wertverzehr und ist nicht planmäßig abschreibbar.
Streitanfällig ist oft die Aufteilungsmethode. Hier soll nun der neue § 9b EStDV für „Klarheit“ sorgen. Danach soll für die Schätzung des Werts des Grund und Bodens sowie des Gebäudeanteils die Immobilienwertermittlungsverordnung einschließlich ihrer Vorgaben zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens heranzuziehen sein.
Zur Vereinfachung soll entsprechend der bisherigen Verwaltungspraxis zudem festgeschrieben werden, dass das Bundesfinanzministerium eine Arbeitshilfe zur vereinfachten Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für das bebaute Grundstück zur Verfügung stellen kann.
Diese Schätzung kann widerlegt werden – und zwar durch Vorlage eines für diesen Zweck nach persönlicher Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken.
Der Immobilienverband Deutschland IVD hat in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf scharf kritisiert, dass Gutachten von Sachverständigen, die nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert sind, somit nicht anerkannt werden sollen.
Kürzere Nutzungsdauer
Ist die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer als die in § 7 Abs. 4 S. 1 EStG typisierten Prozentsätze, kann die Abschreibung nach der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer vorgenommen werden. Hierzu hatte der Bundesfinanzhof (28.7.2021, Az. IX R 25/19) entschieden, dass sich der Steuerpflichtige dabei grundsätzlich jeder Darlegungsmethode bedienen kann, die im Einzelfall geeignet erscheint (Methodenfreiheit).
Durch § 11c Abs. 1a EStDV soll nun festgelegt werden, dass der Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer durch ein Gutachten (Vorortbesichtigung und anerkannte Sachverständige wie bei der Kaufpreisaufteilung) zu erbringen ist. Auch diese Regelung wird vom Immobilienverband Deutschland IVD entsprechend kritisiert.
| Ausblick | Es handelt sich derzeit „nur“ um einen Referentenentwurf, sodass im weiteren Verlauf noch Änderungen möglich sind. |
Quelle | Referentenentwurf des BMF: Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen, Stand: 4.8.2025